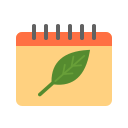This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Nachhaltige Pflanzenauswahl für urbane Landschaften
Eine nachhaltige Pflanzenauswahl ist der Schlüssel zu lebendigen, widerstandsfähigen und ökologisch wertvollen städtischen Landschaften. Im städtischen Raum müssen Pflanzen nicht nur ästhetischen Ansprüchen genügen, sondern auch mit besonderen Herausforderungen wie begrenztem Platz, erhöhten Temperaturen, Luftverschmutzung und wechselnden Wasserverfügbarkeiten zurechtkommen. Durch bewusste Entscheidungen bei der Auswahl und Kombination von Pflanzen können städtische Gärten, Parks und Grünflächen erheblich zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Förderung der Artenvielfalt und zur Schaffung lebenswerter Räume beitragen. Dieser Leitfaden beleuchtet die Prinzipien und Vorteile nachhaltiger Pflanzenauswahl, gibt Einblicke in die Herausforderungen der Stadtbegrünung und bietet praxisnahe Ansätze für den langfristigen Erfolg urbaner Landschaftsgestaltung.

Förderung urbaner Ökosysteme

Klimatische Anpassungsfähigkeit
Herausforderungen urbaner Standorte

Vorteile heimischer Pflanzenarten
Kombination von Zier- und Nutzpflanzen
Essbare Stadtlandschaften
Blühende Oasen für Insekten
Schutz vor Schädlingen und Krankheiten
Wasserressourcen und effiziente Bewässerung
Auswahl trockenheitstoleranter Pflanzen
Intelligente Bewässerungssysteme
Förderung naturnaher Wasserkreisläufe
Lebensräume für urbane Biodiversität
Strukturvielfalt durch mehrschichtige Bepflanzung